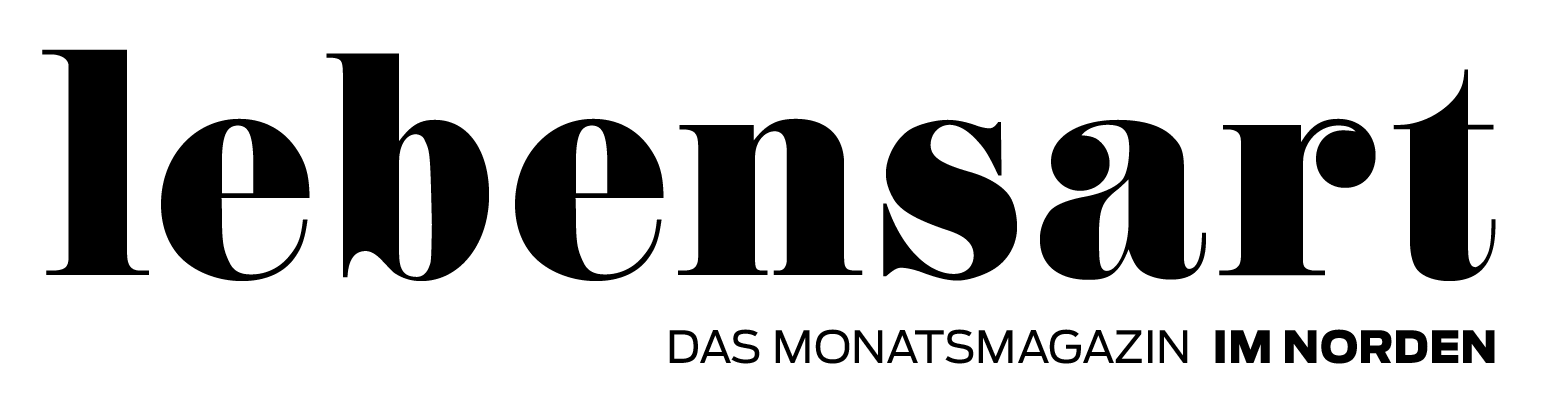Der in Kopenhagen geborene Architekt war ein „Überflieger“. Schon mit zehn Jahren kam er an die Königlich Dänische Kunstakademie und machte eine Maurerlehre. Es war aufgefallen, dass er besonders gut zeichnen konnte. Vom dänischen König Christian VII. wurde er als begabtester Absolvent nach Italien geschickt. Die Reise führte ihn nach Venedig, Vicenza, Bologna, Modena und Rom. Wachsam und sehr geschickt studierte er die Bauten von Andrea Palladio (1508-1580), dem italienischen Baumeister der Spätrenaissance. Unentwegt zeichnete er und setzte sich mit den Stilelementen auseinander. Als er 1784 aus dem Süden zurückkehrte, übernahm er die Kunstakademie und wurde gleichzeitig Landbaumeister für Holstein und Altona. Er hatte sich schon 1782 für diese Stelle beim König beworben. Holstein gehörte zum dänischen Gesamtstaat, in dem Altona die zweitgrößte aufstrebende und weltoffene Stadt war. Er zog dort hin und hinterließ städtebauliche Spuren, die Hamburg bis heute prägen.

Vom Stadtpalais bis zu Landsitzen an der Elbe
Der 29 Jahre alte hochbegabte und hervorragend ausgebildete Architekt musste sich anfänglich mit kleineren Aufgaben begnügen. Er begann mit Reparaturarbeiten an Schlössern und Herrenhäusern in Plön, Glückstadt, Rendsburg und Barmstedt. Nach und nach ergab sich aber ein anspruchsvolleres Arbeitsfeld. Hansen schwebten nach seiner Studienzeit in Italien strengere Formen als der überholte Barockbaustil für den Städtebau vor. Im Geist des aufkommenden Klassizismus orientierte er sich an antiken Formen, Säulenordnungen, Bögen, Gesimsen und Friesen.

Gleichzeitig wuchsen die Wohnansprüche der vermögenden Hamburger Kaufleute und so entwickelte er ein neues Bauprogramm für die baumbestandene Palmaille. Auf der Nord- und Südseite entstanden Stadtpalais, die allen Repräsentationsansprüchen der reichen Bewohner entsprachen. Doch nicht nur in der Stadt, sondern auch an der Elbchaussee errichtete er für das Großbürgertum herrschaftliche Landsitze. Sie waren genauso groß, aber viel schlichter als die Herrenhäuser der Aristokraten.
Gestalterischer Mittelpunkt waren die Säulen. Ein ländlich einfacher Bau bekam dorische, ein eleganter ionische, feiner verzierte Säulen. Heute stehen noch elf von Hansens Gebäuden in Hamburg. 1808 wurde er als Oberbaudirektor nach Kopenhagen berufen. Er sollte dort das abgebrannte Schloss neu aufbauen. Im öffentlichen Auftrag entstanden das Schloss Christiansborg, das Kopenhagener Rats- und Gerichtsgebäude, die Frauenkirche und die Schlosskirche.
Schlichte Gotteshäuser im Serienbau
1831 erkrankte C. F. Hansen schwer. Zur gleichen Zeit aber hatte er noch drei Großprojekte im Bau. Die St. Peter Kirche in Krempe und die Vicelinkirche in Neumünster wurden 1832 fertig gestellt, und 1833 stand auch das Gotteshaus St. Marien in Husum. Alle drei Kirchen beeindrucken bis heute durch ihre Schlichtheit. So sahen es in der Vergangenheit nicht alle. Theodor Storm mied die Kirche seiner Heimatstadt Husum und bezeichnete sie als „Kaninchenstall“.