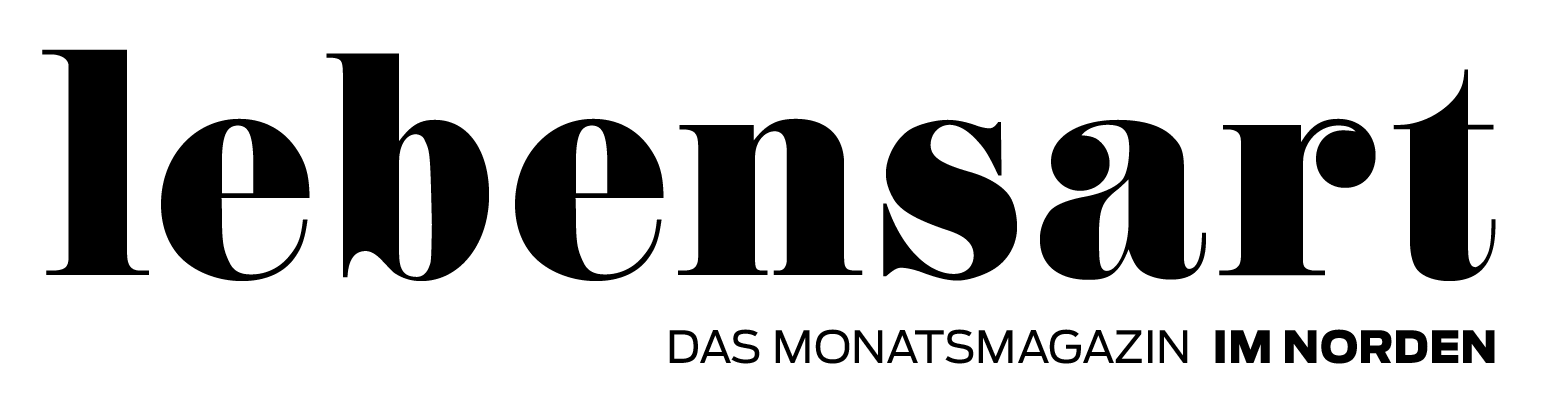Sie ist gerade einmal 12 bis 18 Zentimeter groß, und doch ist sie eine Bereicherung für das Ökosystem Meer: die Europäische Auster. Seit 1930 gelten die Schalentiere in der deutschen Nordsee allerdings als ausgestorben. In zwei Forschungsprojekten widmen sich Wissenschaftler:innen des Alfred-Wegener-Institutes (AWI) der Wiederansiedlung.
Die Zahlen sind erschreckend: In den letzten 150 Jahren sind die Austernriffe weltweit um mehr als 85 Prozent zurückgegangen. Nicht nachhaltige Fischfangmethoden, vor allem mit Bodenschleppnetzen, aber auch Faktoren wie Umweltverschmutzung, Krankheiten und Klimawandel haben den wertvollen Lebensräumen im Lauf der Jahre schwer zugesetzt – so auch der Europäischen Auster. Im Gegensatz zu der Pazifischen Auster, die wir als exklusives Genussmittel kennen, war sie lange Zeit in europäischen Gewässern heimisch. Ursprünglich reichte ihr natürliches Verbreitungsgebiet von Norwegen bis nach Marokko sowie entlang der Küsten des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es auch großflächige Austernbänke in der Deutschen Bucht.
Schutz- und Lebensraum
Austernriffe haben einen großen Nutzen für unsere Umwelt und gelten als Hotspots biologischer Vielfalt. So sind sie eine ideale Kinderstube und Laichgrund für verschiedene Fischarten, bieten vielen weiteren Tier- und Pflanzenarten Schutz sowie Nahrung und tragen so erheblich zur Biodiversität bei. Denn auch auf ihren Schalen leben zahlreiche kleine Organismen. Zudem filtert eine einzige Auster pro Tag ganze 240 Liter Meerwasser, was zu einer erheblichen Verbesserung der Wasserqualität beiträgt. Auch zum Küstenschutz leisten die Riffe einen wichtigen Beitrag, indem sie lose Sedimente am Meeresboden stabilisieren. „Damit gilt die Europäische Auster als ökologische Schlüsselart”, sagt Dr. Bernadette Pogoda vom AWI Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und auf Helgoland. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiter:innen und dem Bundesamt für Naturschutz verantwortet sie die Projekte RESTORE und PROCEED zur Wiederansiedlung der Europäischen Auster in der deutschen Nordsee.
Aufzucht auf Helgoland als Grundlage

Mit einer Aufzuchtanlage auf Helgoland leistet PROCEED praktisch die Grundlagenarbeit. Auf der Insel widmen sich die Forscher:innen der Produktion sogenannter Saataustern für die Wiederansiedlung, aber auch der Optimierung von Futtermitteln wie Grün-, Braun- und Rotalgen für die Versorgung der Austern sowie der Larvenaufzucht mit neuesten Methoden und Technologien. Ziel ist es, junge Austern auf leeren Austernschalen heranzuziehen, die sich dann für die Ausbringung im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen eignen.
Pilotriff vor Borkum
Um die direkte Wiederansiedlung kümmert sich das Projekt RESTORE. 2017 wurden vor dem Helgoländer Felssockel wenige Millimeter große Saataustern in Austernkörben angebracht und über zwei Jahre untersucht. Ein Feldversuch, der von großem Erfolg gekrönt war: So zeigten verschiedene Untersuchungen, dass die Austern in der Nordsee ideal wachsen und sich entwickeln können. Schnell siedelten sich rund um die Muscheln Lebewesen wie Meeresnacktschnecken und Anemonen an. Die Körbe hängen bis heute an ihrem ursprünglichen Standort. 2020 erfolgte dann der nächste Schritt: Seitdem entsteht im Meeresnaturschutzgebiet Borkum Riffgrund ein Pilotausternriff. 100.000 Jungaustern wurden darauf angesiedelt. Um einen idealen Nährboden für das Wachstum zu schaffen, haben die Forscher:innen außerdem 80 Tonnen Kalkstein und leere Austernschalen auf dem Meeresboden ausgebracht.
Weitere Standorte geplant
Es ist der erste groß angelegte Versuch, die Europäische Auster in die deutsche Nordsee zurückzuholen. Biologische und ökologische Untersuchungen am Riff sollen in den kommenden Jahren weitere Erkenntnisse bringen. „Unser Ziel ist es, zukünftig auch an anderen Standorten im Schutzgebiet Borkum Riffgrund Austernriffe zu etablieren”, so Pogoda. Es besteht also die berechtigte Hoffnung, dass langfristig wieder Austernriffe in der deutschen Nordsee entstehen und hier zum Schutz des Ökosystems Meer und zur Artenvielfalt beitragen.