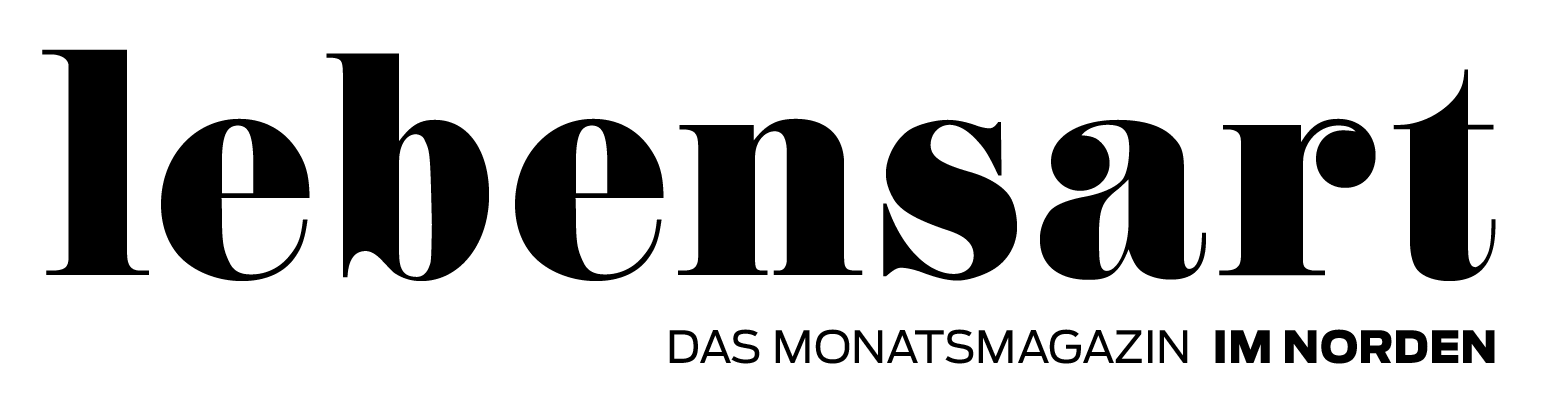Vor 40 Jahren wurde der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer gegründet – damals begleitet von heftigen Protesten, heute gefeiert als einzigartiges Naturparadies und UNESCO-Weltnaturerbe. Zum 40. Geburtstag sprachen wir mit dem schleswig-holsteinischen Umweltminister Tobias Goldschmidt über Erfolge, aktuelle Herausforderungen und die Frage, wie der Nationalpark für die nächsten 40 Jahre aufgestellt ist.
Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer – rund 4.410 Quadratkilometer umfasst das Schutzgebiet an der Nordseeküste, das Millionen Zugvögeln als Rastplatz dient und ein Rückzugsort für unzählige Tier- und Pflanzenarten ist. Doch der Nationalpark steht auch unter Druck: Klimawandel, Meeresspiegelanstieg, Nutzungsinteressen und Artenverlust fordern Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Wir befragten zu diesen Themen Tobias Goldschmidt, Umweltminister des Landes Schleswig-Holstein.
Herr Minister, der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer wird dieses Jahr 40 Jahre alt – was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Errungenschaft in dieser Zeit?
Tobias Goldschmidt: Im Nationalpark gilt das Prinzip „Natur Natur sein lassen“ – und wie sich das auszahlt, sehen wir heute. Seit über 40 Jahren erforschen, erleben und schützen wir diesen einzigartigen Lebensraum mit seinen Watten, Prielen, Salzwiesen, Dünen, Stränden und Geestkliffs, seine Pflanzen und Tiere. Mit dem Nationalparkgesetz konnten wir dieses einzigartige Ökosystem mit seinen Millionen an Zugvögeln erhalten und nachhaltig verbessern. Und weil das Ganze mit und für die Menschen passiert, erfährt der Nationalpark heute eine riesengroße Zustimmung aus der Bevölkerung.
Der Nationalpark war bei seiner Gründung stark umstritten. Wie hat sich das Bild des Nationalparks in der Bevölkerung seitdem verändert?
Es hat sich grundlegend geändert. Gegen neue große Schutzgebiete regt sich fast immer erstmal Widerstand. Das war auch vor 40 Jahren so, als die damalige Landesregierung trotz erheblicher Widerstände den Nationalpark Wattenmeer gegründet hat. Diesen Mut und die Weitsicht bewundere ich – denn inzwischen wissen wir und auch die Menschen vor Ort, wie richtig diese Entscheidung war. Die Menschen in den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen sind stolz auf dieses UNESCO-geschützte Naturwunder. Das zeigen regelmäßige Befragungen.
Wie sieht es aktuell mit der Balance zwischen Schutz und Nutzung des Parks aus – z. B. in Bezug auf Fischerei, Tourismus oder Offshore-Windenergie?
In den 40 Jahren der Nationalparkentwicklung wurden viele gute Lösungen gefunden. Der Nordseetourismus zum Beispiel ist inzwischen regelrecht Partner des Nationalparks. Natürlich steht in einem Nationalpark der Naturschutz an allererster Stelle, aber das Naturerleben gehört einfach dazu und ist gewollt. Besucherinnen und Besucher lieben Wattwanderungen, Salzwiesenführungen oder vogelkundliche Exkursionen. Dass man auf brütende Vögel Rücksicht nehmen muss und die Kernzone des Nationalparks nicht betreten darf, wird im Regelfall sofort verstanden und auch akzeptiert. Weil die Nationalparkverwaltung eng mit den Kommunen, den touristischen Anbietern und den Naturschutzverbänden zusammenarbeitet, lassen sich vor Ort immer tragfähige Lösungen finden.
Die Fischerei ist ebenfalls ein wichtiger Partner im Nationalpark und gleichzeitig einer der größten Nutzer. Mit der Muschelfischerei konnte bereits vor einigen Jahren eine gute Einigung geschlossen werden, mit der die Muschelnutzung nun nationalparkverträglich und gleichzeitig ökonomisch tragfähig gestaltet ist. Mit der traditionellen Krabbenfischerei bin ich in einem intensiven Dialog über eine ebenso nationalparkverträgliche Zukunft. Davon sind wir leider noch ein Stück weit entfernt, aber es ist Vertrauen gewachsen.
Offshore-Windenergieanlagen sind im Nationalpark natürlich tabu, aber natürlich müssen Anbindungskabel zu den Parks weiter draußen auf See den Nationalpark durchqueren. Wir bündeln alle Kabelsysteme auf einer einzigen Trasse nördlich von Büsum. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Naturschutz und Energiewende.
Im Oktober 1998 kam es zur Havarie des Frachtschiffes Pallas vor Amrum. Wissen Sie noch, was Sie zu dem Zeitpunkt gemacht haben? Was haben Sie damals empfunden und wie denken Sie heute darüber?
Im Oktober 1998 hat sich die erste rot-grüne Bundesregierung gebildet. Das fand ich natürlich klasse. Die Bilder der brennenden Pallas waren hingegen beklemmend und eine Mahnung. Heute ist klar: Deutschland hat aus der Pallas-Havarie die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Der Bund und die Küstenländer haben gemeinsam das Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven gegründet, das unter anderem die Vorsorge und Bekämpfung von Schadstoffunfällen auf See koordiniert. Auf vergleichbare Unfälle können wir heute daher deutlich koordinierter und damit effektiver reagieren als damals – und damit die Umwelt viel besser schützen. Allerdings sind auch die Risiken gewachsen: Russische Schattenflotte, Flüssiggastransporte und ein stark zunehmender Schiffsverkehr sind neue Herausforderungen.
Was sagen Ihnen die aktuellen Daten zum Zustand des Wattenmeeres? Wo stehen wir und unser Nationalpark?
Wie in fast allen europäischen Meeren ist auch der Zustand der Nord- und Ostsee besorgniserregend. Das gilt auch für das Wattenmeer. Schutzgebiete wie der Nationalpark sind daher umso wichtiger und schaffen zwingend nötige Rückzugs- und Ruheräume für Arten und Lebensräume. Für den Schutz gefährdeter Arten und Lebensräume und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt sind Schutzgebiete daher unverzichtbar. Sie sind eine Investition in die Zukunft.
Wie muss sich der Nationalpark weiterentwickeln, um auch in 40 Jahren noch als Erfolg zu gelten?
Um unseren Nationalpark erfolgreich weiterzuentwickeln, müssen wir vor allem die Natur weiter konsequent schützen. Dazu gehört aber auch, eng alle Interessensvertretungen an der Westküste einzubinden – vom Tourismus über die Fischerei bis hin zu den Energiewendeakteuren. Und nicht zuletzt braucht es für dieses internationale Schutzgebiet eine gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbarländern und -staaten im Wattenmeer. Und der steigende Meeresspiegel wird auch das Wattenmeer stark verändern. Hierauf müssen wir Antworten finden.
Was wünschen Sie sich ganz persönlich für dieses einmalige Weltnaturerbe?
Ich wünsche mir für den Nationalpark noch mehr Wildnis. Damit meine ich zusammenhängende Flächen, in denen sich die Natur ohne jegliche Nutzung selbst entfalten kann. Davon gibt es bislang zu wenige. Uns Menschen bietet das Wattenmeer großartige Naturerlebnisse, die sonst nirgendwo in Deutschland erlebbar sind. Dieses Ökosystem ist aber durch die vielen Nutzungen, aber auch durch Verschmutzung oder den Klimawandel bedroht. Wenn wir das Wattenmeer auf noch größerer Fläche wirklich in Ruhe lassen, wird es auch für die Zukunft erhalten bleiben.

Umweltminister Tobias Goldschmidt beantwortete unsere Fragen zu 40 Jahre Nationalpark Wattenmeer.